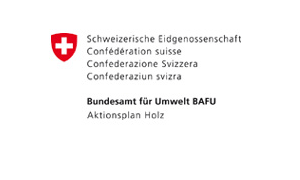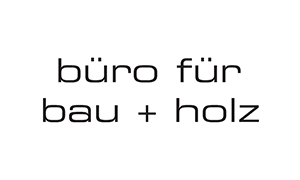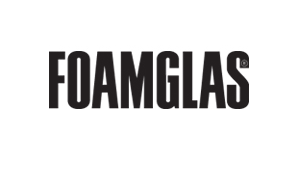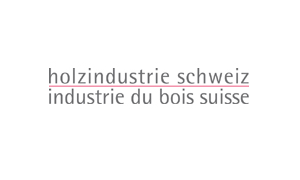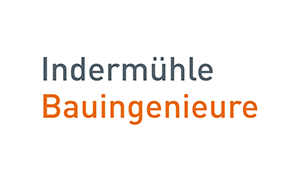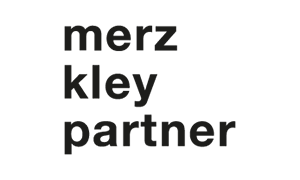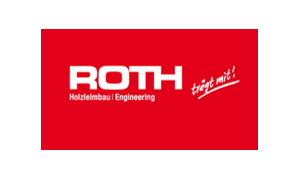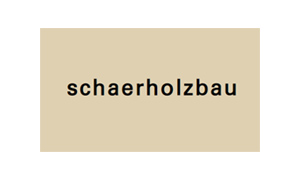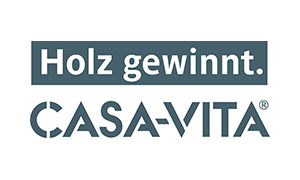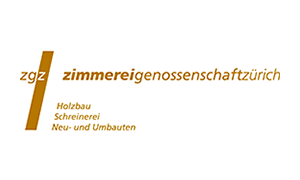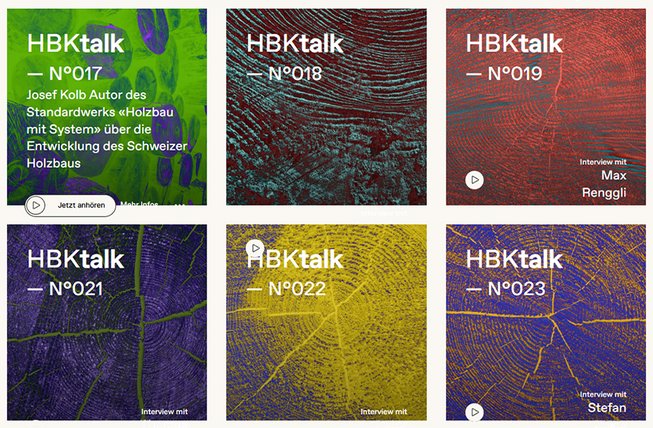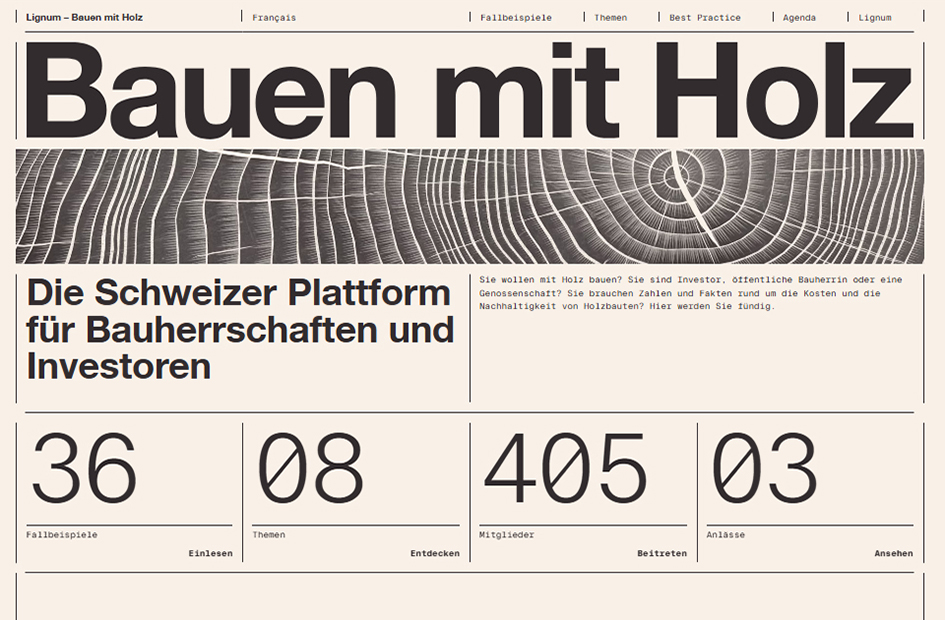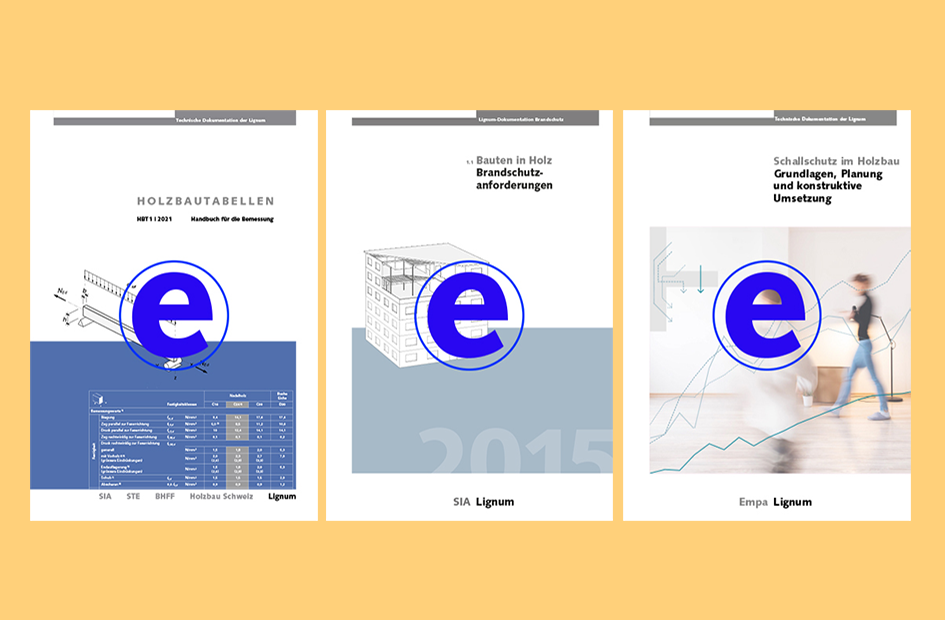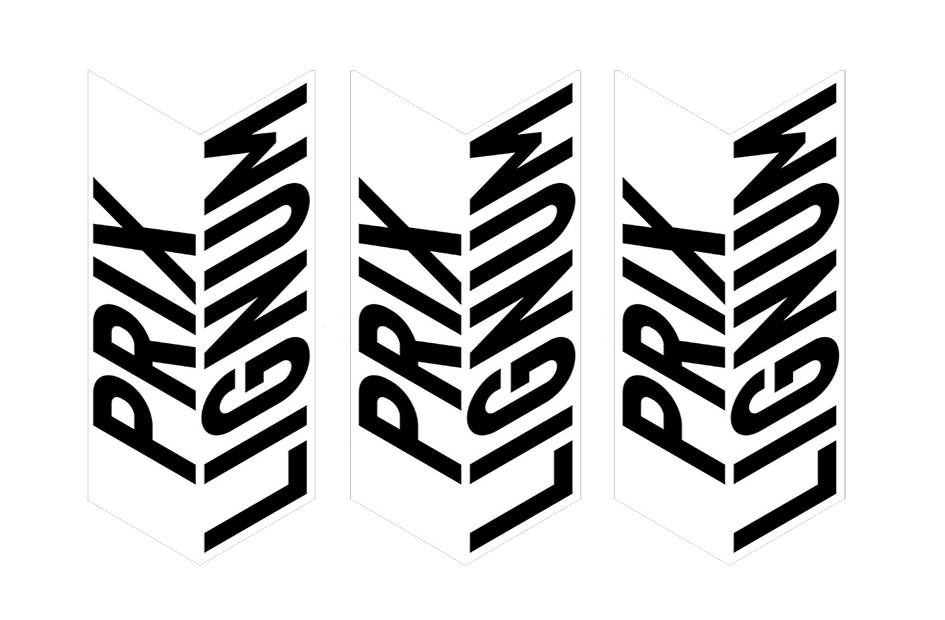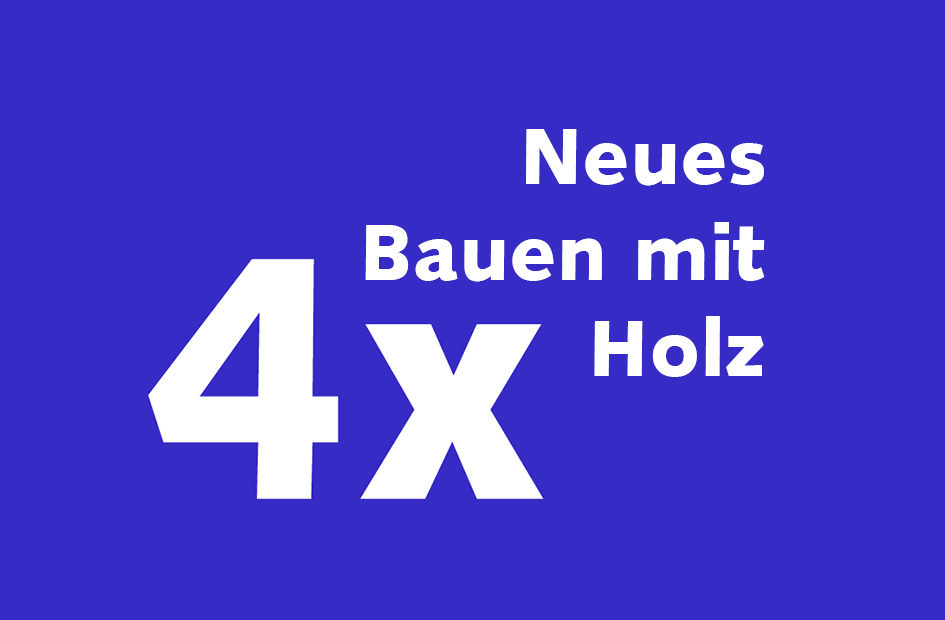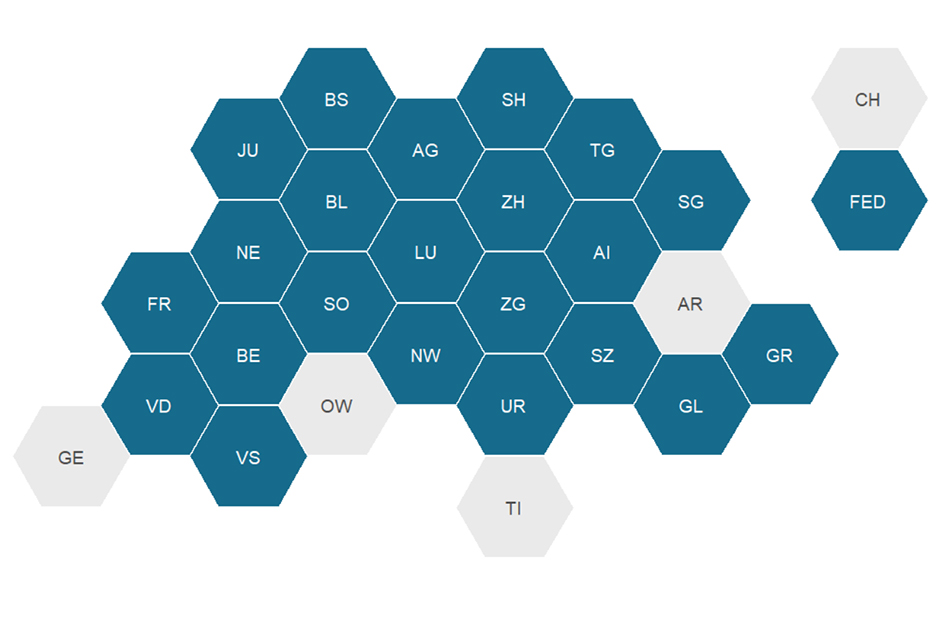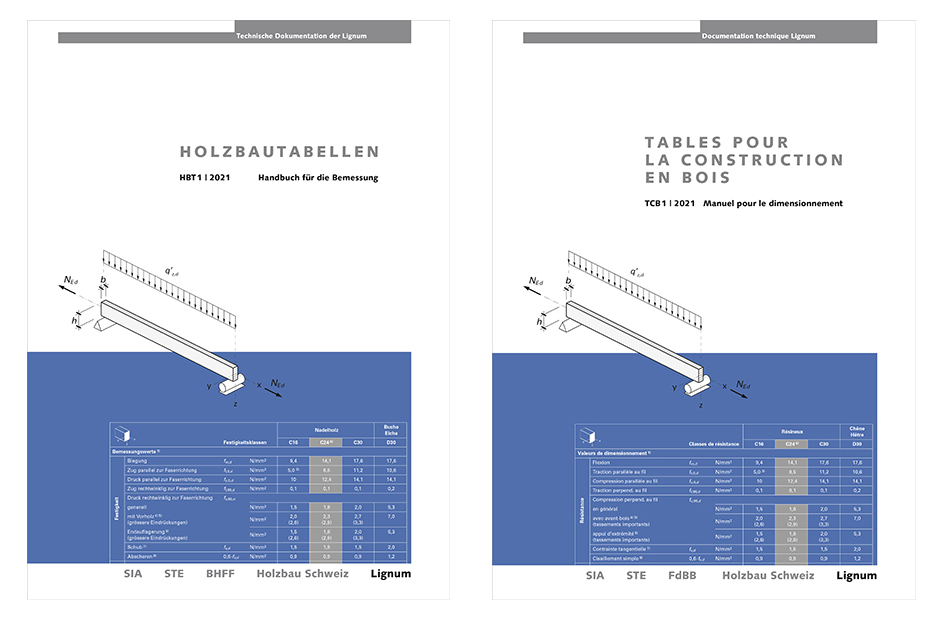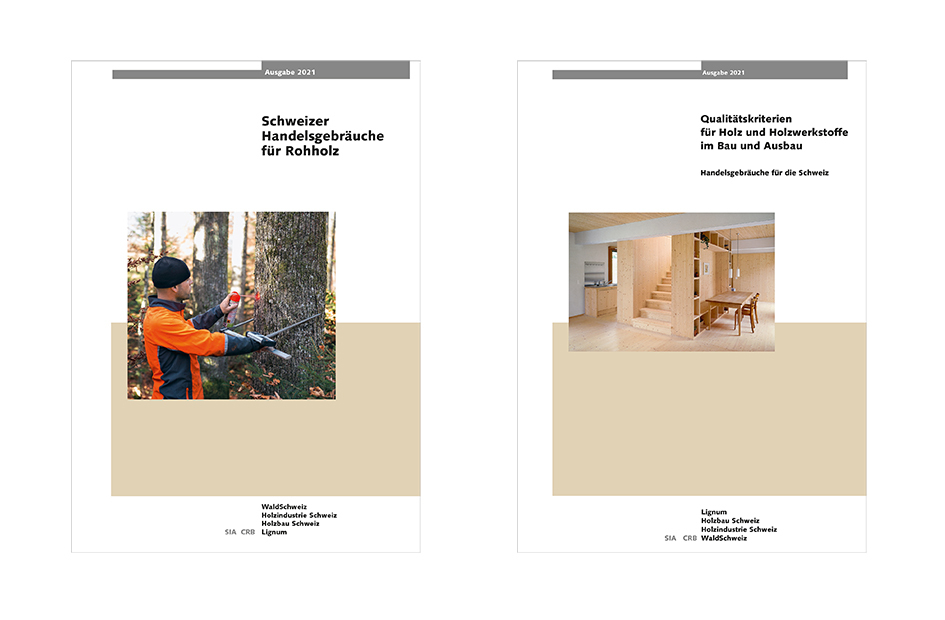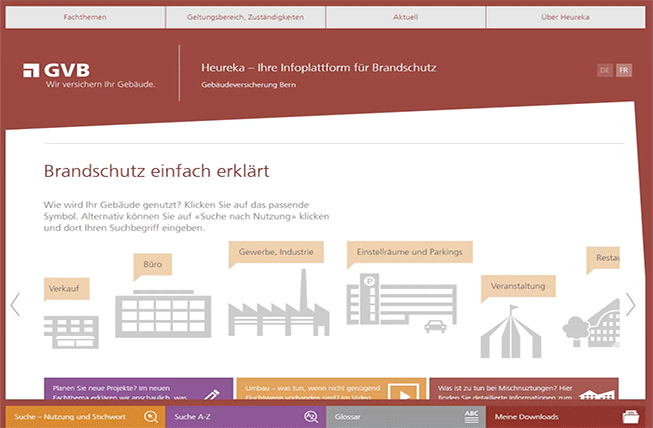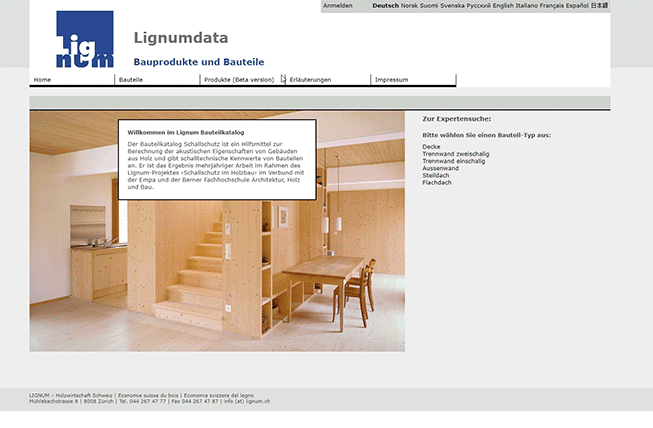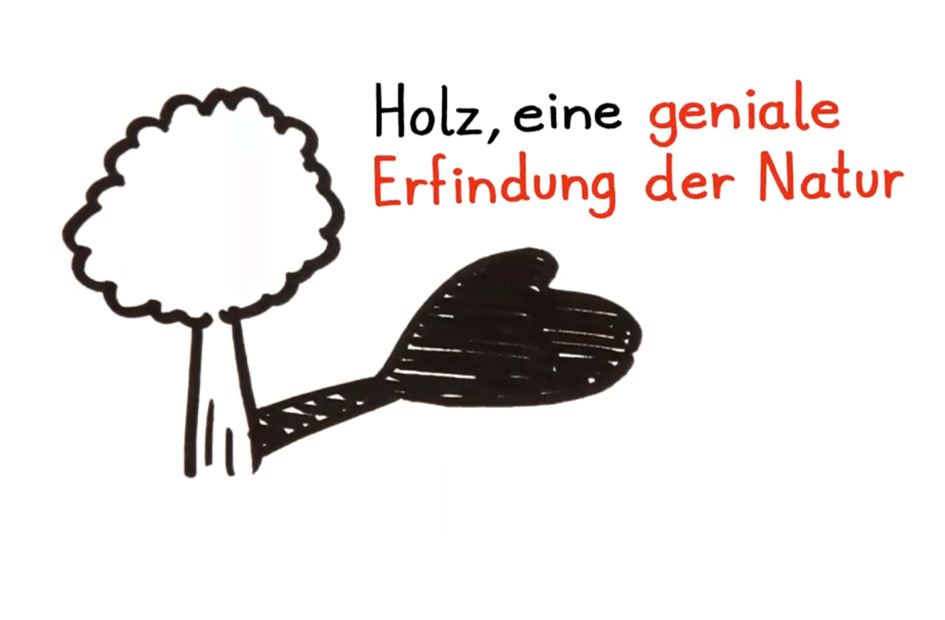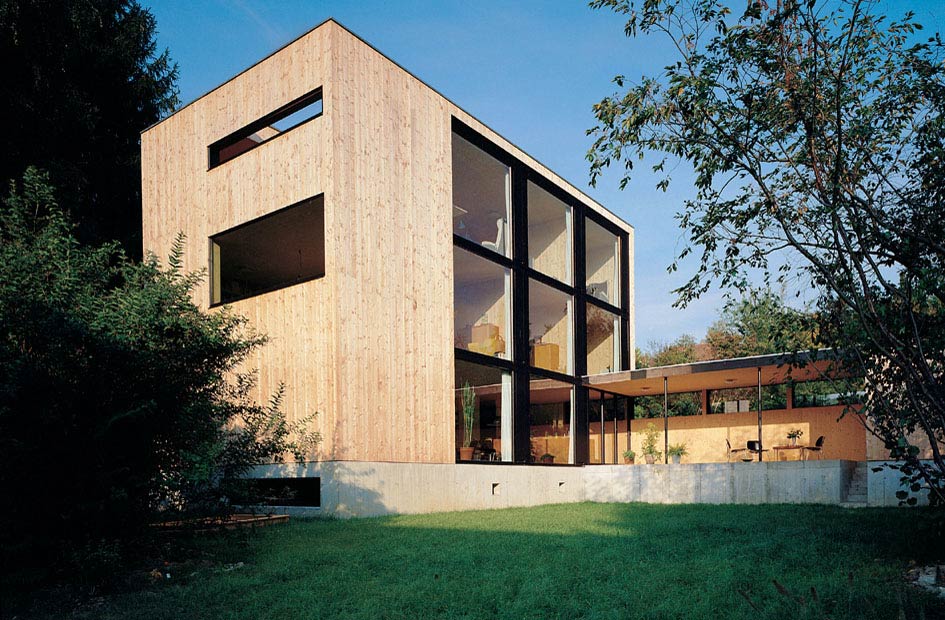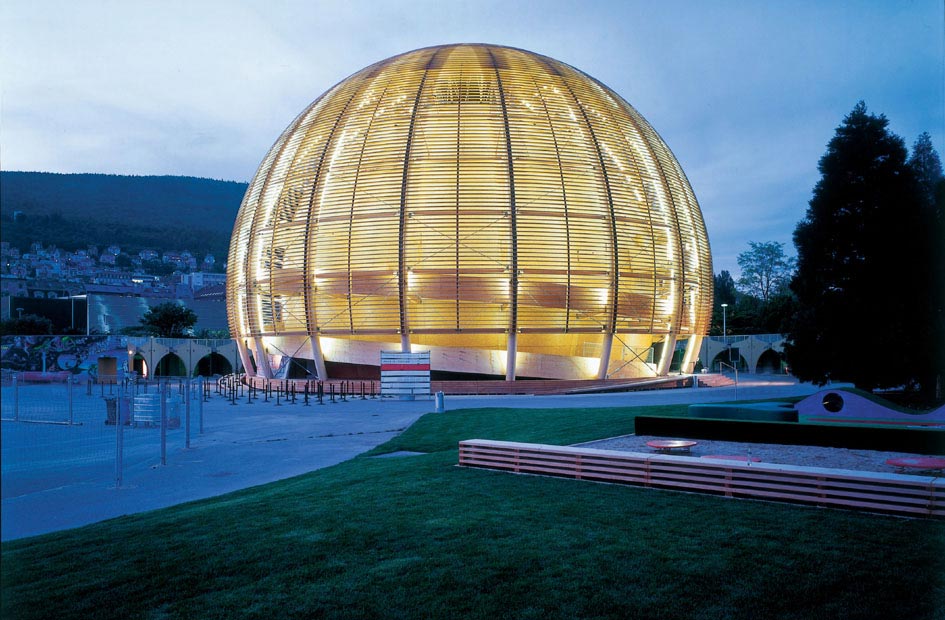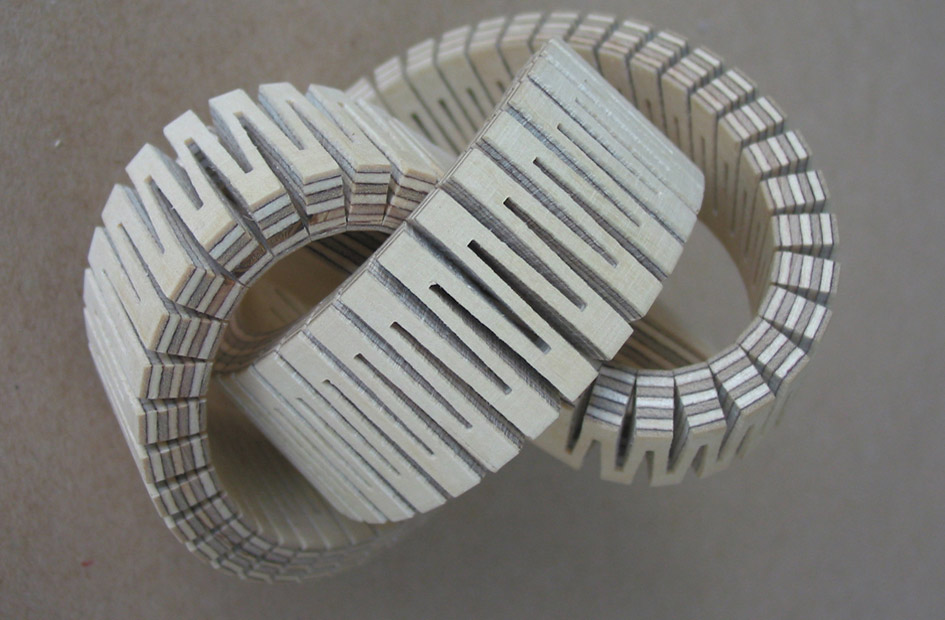Lehren aus ‹Lothar›: Wie der Orkan den Wald umbaute

‹Lothar› riss grosse Schneisen in den Wald. Die meisten Schäden entstanden im Mittelland. In den folgenden Jahren, insbesondere nach dem Hitzejahr 2003, fügten Massenvermehrungen von Borkenkäfern noch einmal fast zwei Drittel so viel geschädigtes Holz hinzu wie der Sturm selbst.
Bild Reinhard Lässig, WSL
Auf vielen grossen Windwurfflächen sind Bäume nachgewachsen, die heute im Mittel 10–20 m hoch sind. Es gibt aber im Mittelland – je nach Bodeneigenschaften und Ausgangsvegetation – auch Flächen, wo Brombeeren oder Adlerfarn die jungen Bäume lange ausbremsten oder wo nicht die gewünschten Baumarten, sondern zum Beispiel Haseln gedeihen. Wo der Sturm in tieferen Lagen viele – zumeist gepflanzte – Fichten umgeworfen hatte, sind von Natur aus zumeist klimarobustere, artenreiche Laubmischwälder entstanden, etwa mit Eiche, Kirsche, Berg- und Spitzahorn.
Die Langfristbeobachtung förderte auch Überraschendes zutage: So fehlte häufig eine Pionierphase mit schnell wachsenden Baumarten wie Birke und Weiden. Das heisst, auf vielen Flächen wuchsen einfach die Nachkommen der Baumarten des umgeworfenen Waldes. Ausserdem blieb trotz Räumung auf den Windwurfflächen viel Totholz liegen, viel mehr, als in Schweizer Wäldern üblich ist. Das war ein Plus für die Biodiversität.
Ein Fest für Insekten – auch ungeliebte
Durch ‹Lothar› sind manche Wälder strukturreicher geworden, was neue Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten schuf. Die Insektenvielfalt explodierte geradezu nach dem Sturm; dies zeigte eine 20 Jahre dauernde Studie der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Die positive Wirkung auf die Artenvielfalt nahm zwar allmählich wieder ab, als Sträucher und Bäume die Sturmflächen überwuchsen, hielt aber auch 20 Jahre nach dem Sturmereignis noch an.
Weniger erfreulich ist bei Sturmschäden in fichtenreichen Beständen die Begünstigung des Borkenkäfers, der sich für einige Jahre fast immer stark vermehrt. Das betrifft zuerst den Randbereich der Sturmflächen, danach auch den angrenzenden, geschwächten Bestand. Müssen wichtige Waldfunktionen geschützt werden, gilt es besonders in Tieflagen, beschädigte Fichten so rasch wie möglich zu räumen und zu verhindern, dass die Käfer lebende Bäume befallen.
Link www.wsl.ch