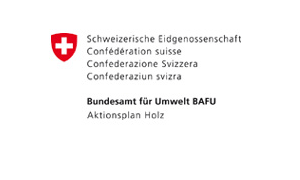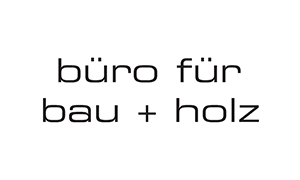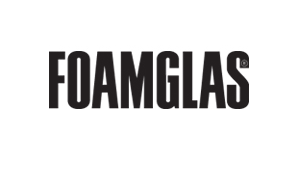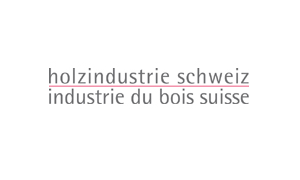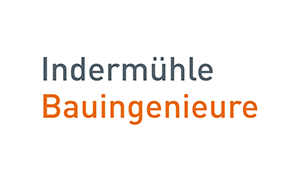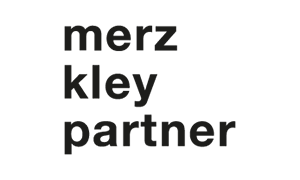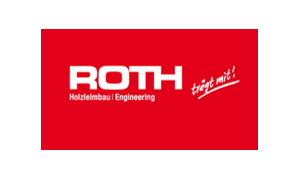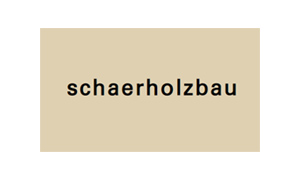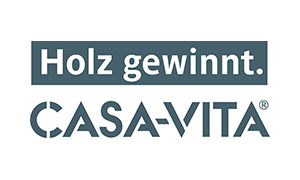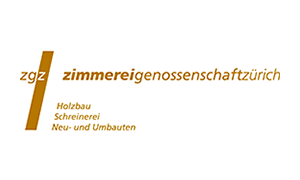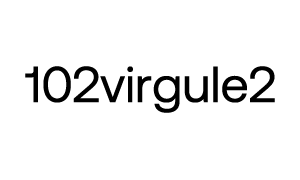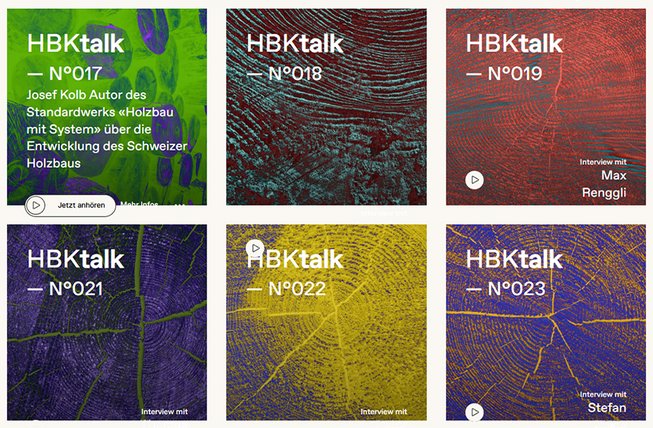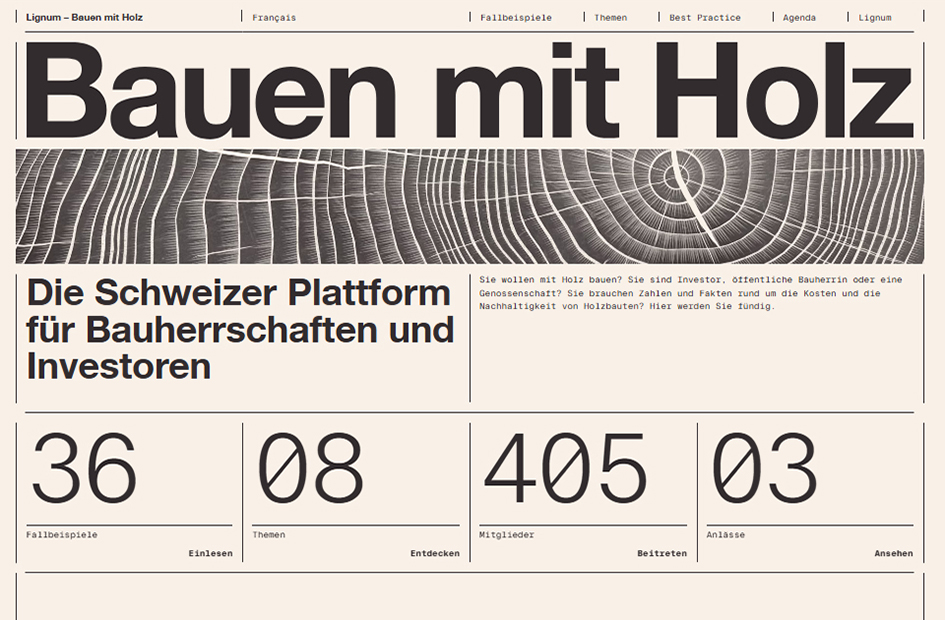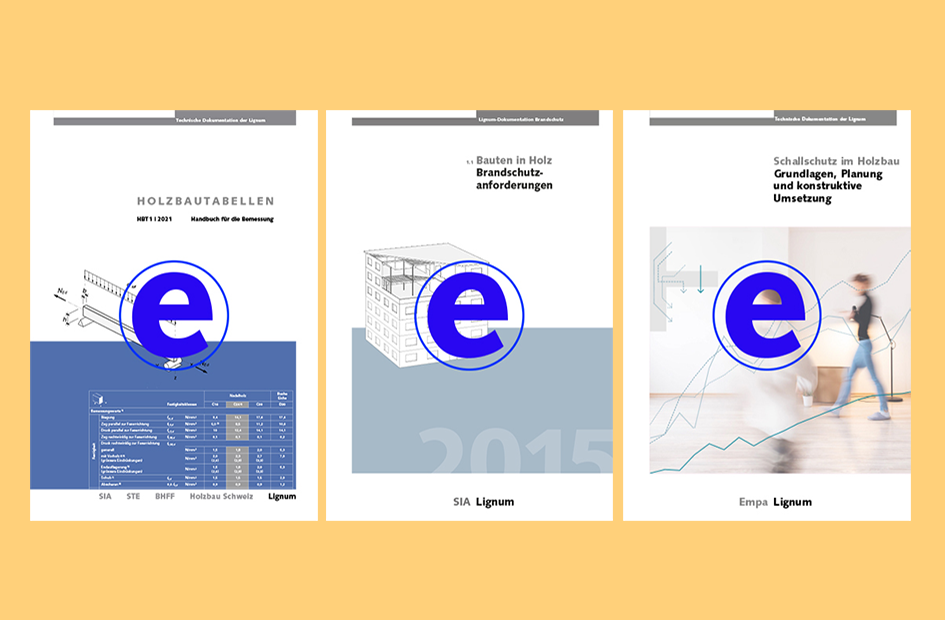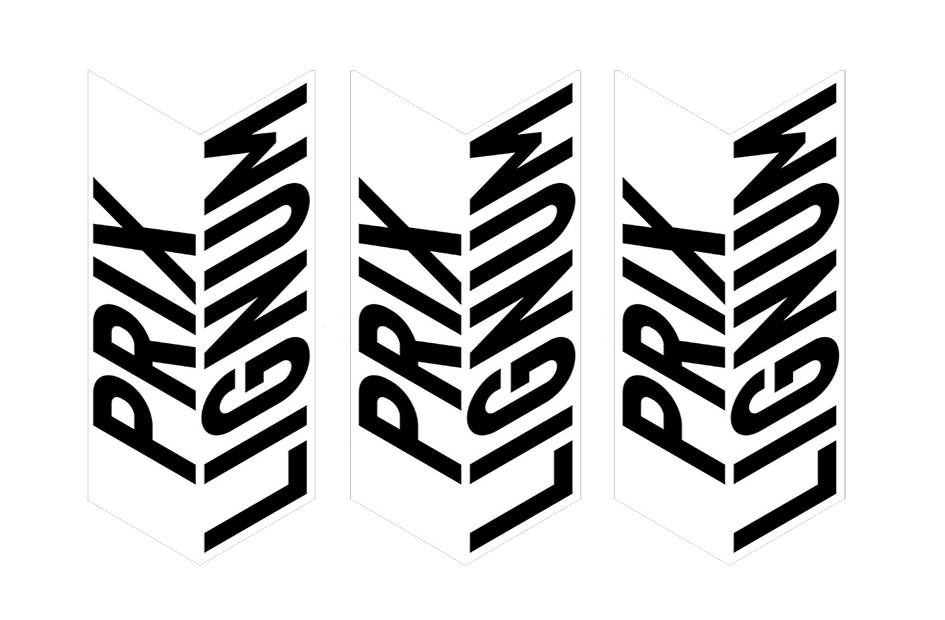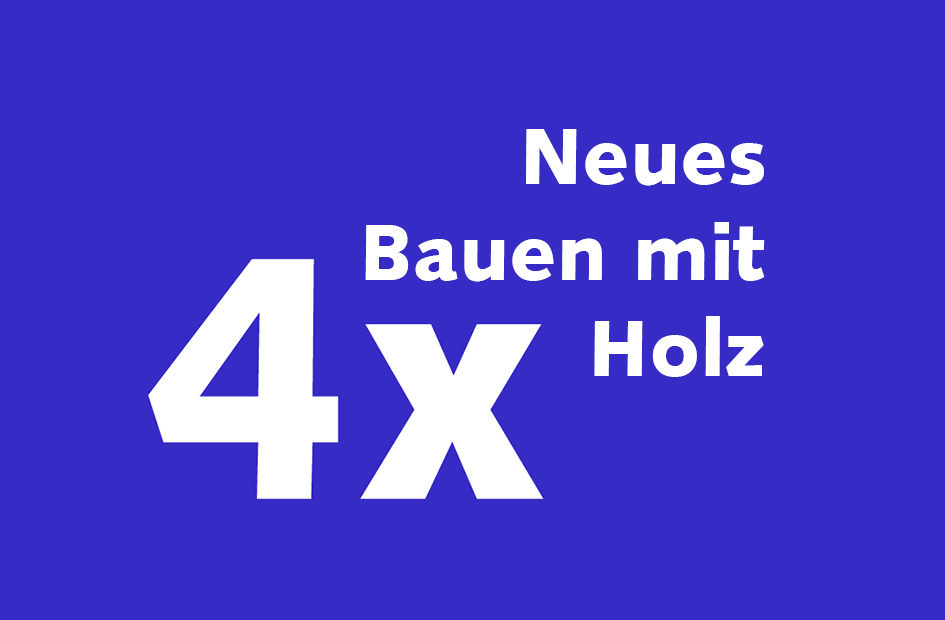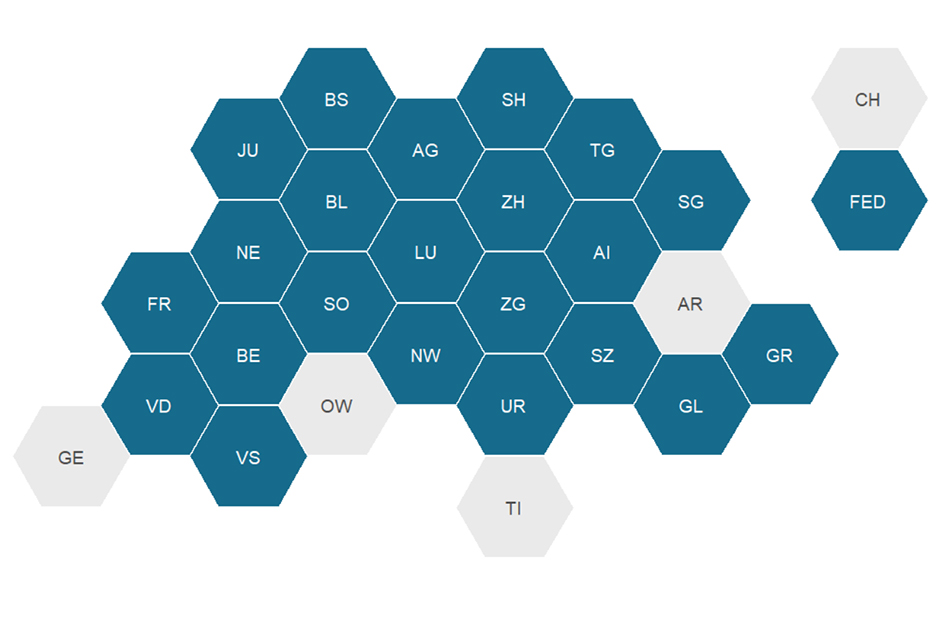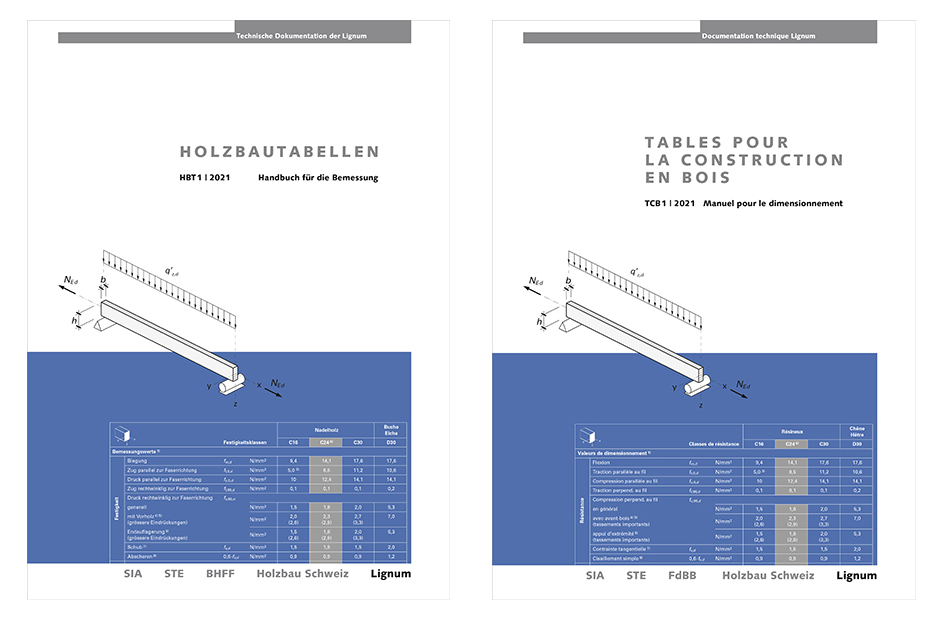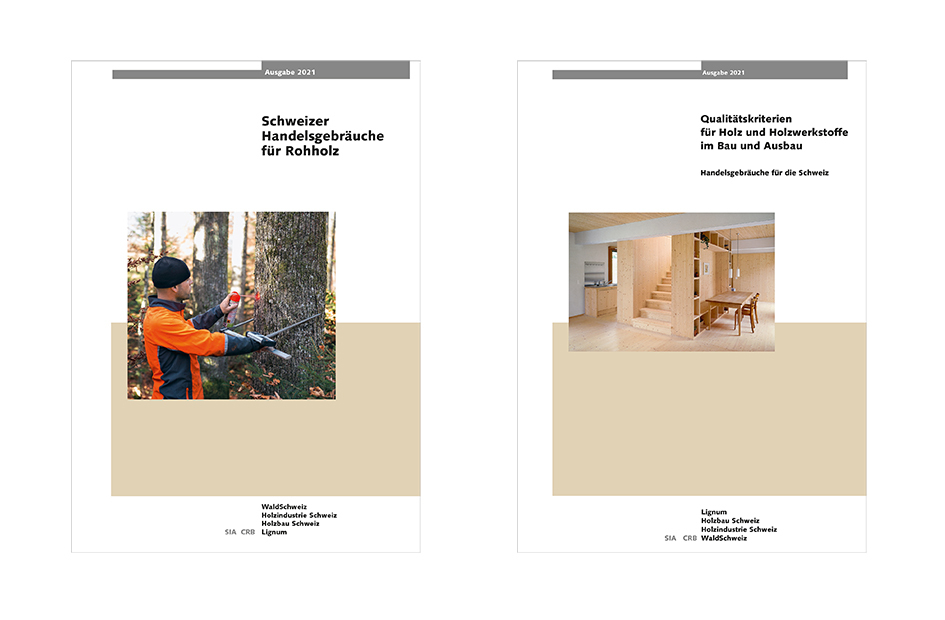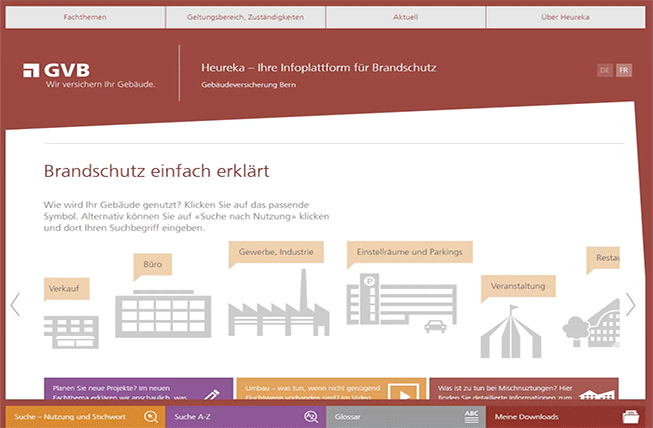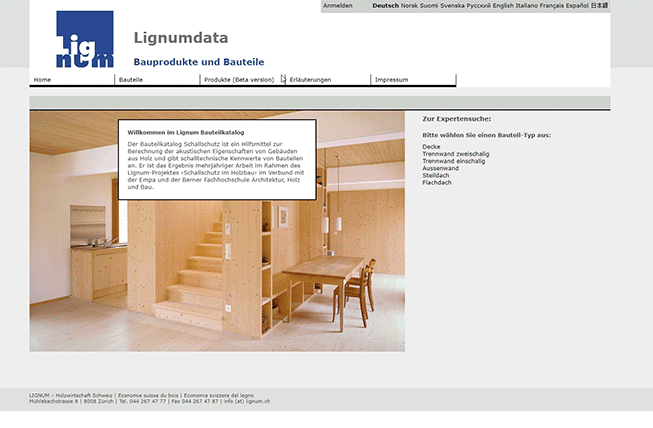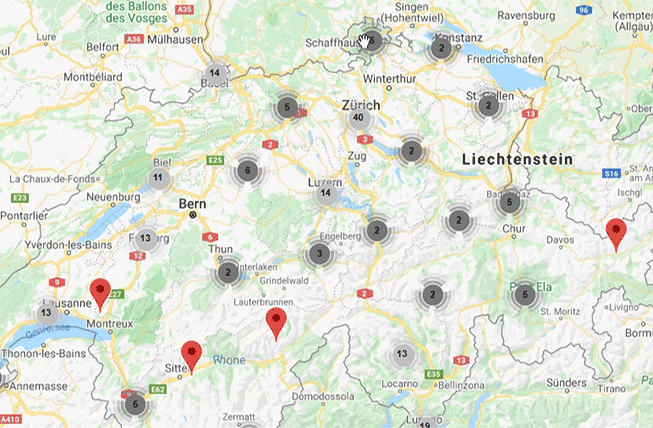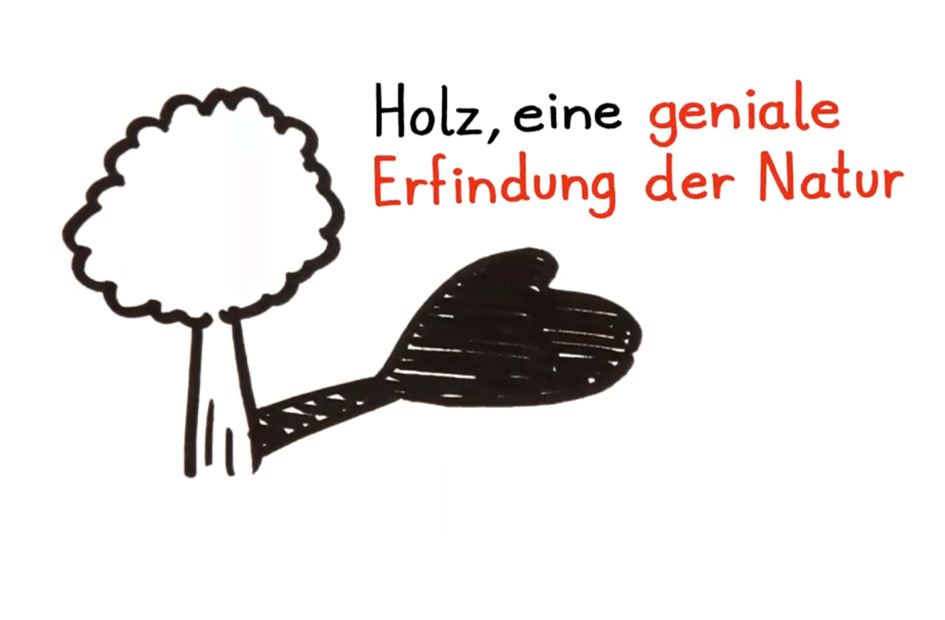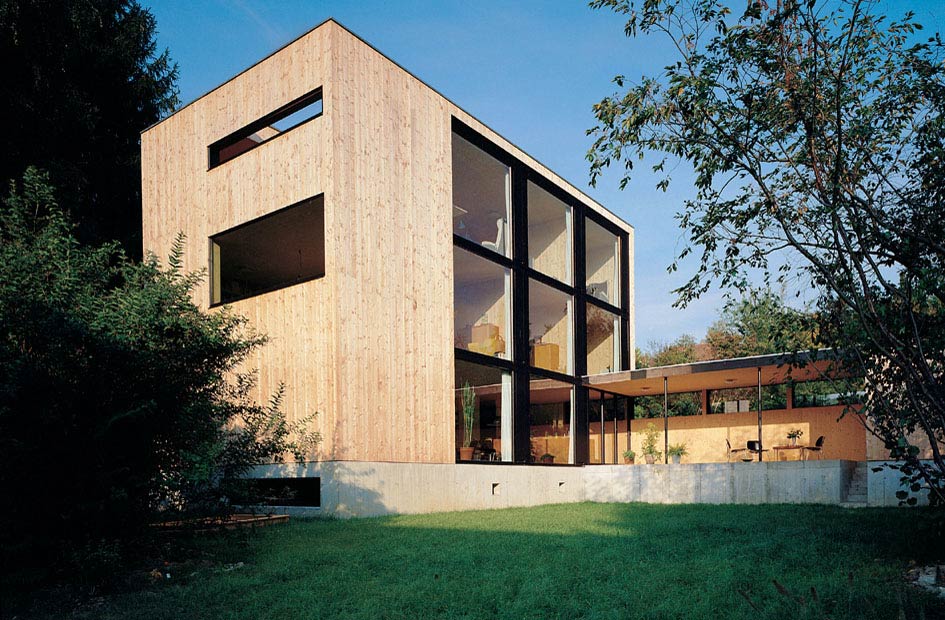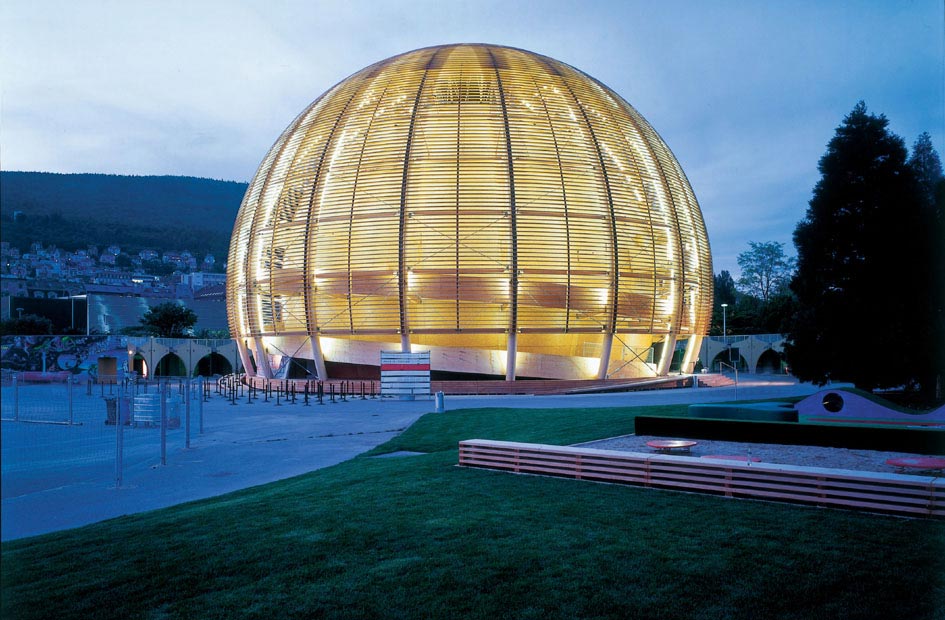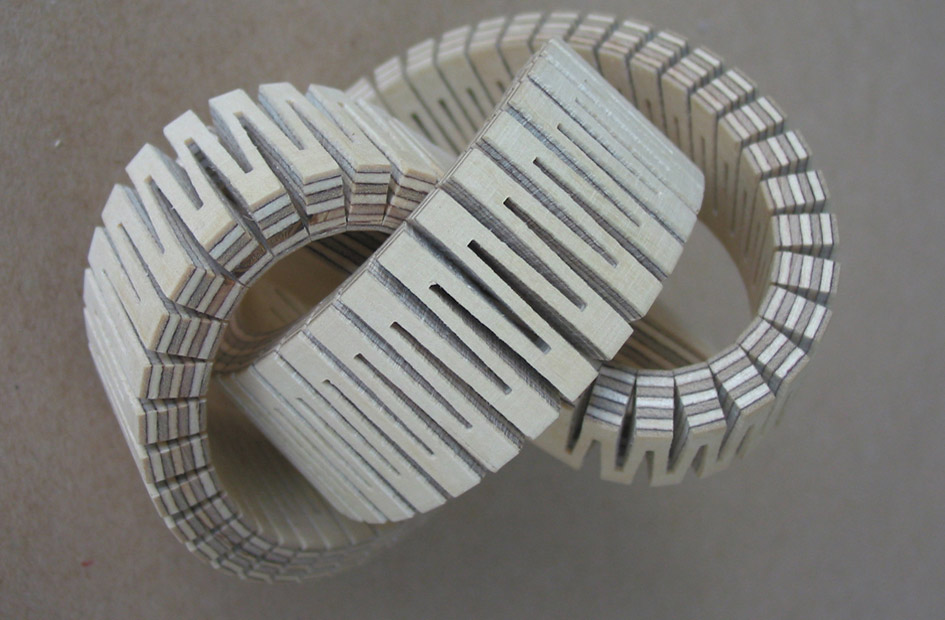Tagungsband
Die mit rund 100 Teilnehmenden gutbesuchte Tagung wurde durch eine sorgfältig gestaltete Drucksache begleitet, die sämtliche Beiträge mit schwarzweissen Illustrationen enthält. Der Tagungsband zur ETH-Tagung kann als SIA-Dokumentation D 0251unter dem nachfolgenden Link bei Lignum bezogen werden.
Link <link shop sia_dokumentationen>www.lignum.ch/shop/sia_dokumentationen/
Der klar fokussierte Anlass behandelte die wesentlichen Themen: die visuelle und maschinelle Sortierung der Bretter und Lamellen und ihre mechanischen Eigenschaften, die Stabilität druckbeanspruchter Bauteile aus Brettschichtholz – kurz BSH –, das Brandverhalten und die Sicherheit verklebter tragender Holzbauteile sowie Fragen zu deren Bemessung und Möglichkeiten einer Verstärkung. Unter der Leitung von Prof. Dr. Andrea Frangi (Institut für Baustatik und Konstruktion, ETH Zürich) präsentierten Fachleute der ETH, der Empa, der Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau in Biel sowie ein praktisch tätiger Bauingenieur neue Erkenntnisse.
Neue Bauproduktegesetze – veränderte Rahmenbedingungen
Die neuen europäischen Bauproduktegesetze und die entsprechenden Normen, welche die Anforderungen an das Herstellen, Überwachen und Inverkehrbringen aller normierter Bauprodukte regeln, wirken sich auch im Schweizer Baumarkt aus. Mit einem KTI-Forschungsprojekt (9843.1 PFES-ES) wurde aufgezeigt, dass Schweizer BSH diesen strengen Auflagen und Anforderungen genügt. Christophe Sigrist (BFH-AHB) stellte das Forschungsprojekt im Detail vor und hielt fest, dass in der Schweiz die Norm DIN 4074-1 der visuellen Sortierung der Bretter zugrunde liege.
Die Holzsortierung sei und bleibe aufwendig, betonte Sigrist. Doch zeigten die zahlreichen begleitend durchgeführten non-destruktiven Messungen mittels verschiedener Instrumente, dass das Schweizer Holz durchaus die für die Herstellung von BSH erforderlichen mechanischen Eigenschaften aufweise. Zudem habe sich erwiesen, dass die Schweizer BSH-Hersteller in der Lage seien, qualitativ hochstehende Produkte herzustellen, und auch wüssten, wann und wo besondere Aufmerksamkeit erforderlich sei. Hauptprojektpartner waren die Schweizer Fachgemeinschaft Holzleimbau, Holzindustrie Schweiz und drei Sortiermaschinenhersteller.
Brettschichtholz aus maschinell sortierten Lamellen
Die grosse Variabilität der Festigkeitseigenschaften von Holz motivierten Gerhard Fink (Empa Dübendorf) im Rahmen seiner letztes Jahr abgeschlossenen Promotionsarbeit (ETH Diss. Nr. 21746, 2014) zu einer Untersuchung über Brettschichtholz aus maschinell sortierten Lamellen. Dabei interessierte vorab der Einfluss von streuenden Materialeigenschaften auf das Tragverhalten von BSH-Trägern. 400 Holzbretter wurden zerstörungsfrei untersucht, zum Beispiel auf Lage und Grösse der Äste oder bezüglich des dynamischen Elastizitätsmoduls.
Zudem wurden auch Zugversuche bis zum Bruch durchgeführt und so die Festigkeit von Astgruppen ermittelt. Aus den zerstörungsfrei untersuchten Brettern wurden BSH-Träger produziert. Deren Aufbau war demnach in jeder Einzelheit bekannt. Bei der anschliessenden Untersuchung des Tragverhaltens wurde insbesondere auf den Einfluss lokaler Schwachstellen wie Astgruppen oder Keilzinkenverbindungen geachtet.
Nebst diesen experimentellen Untersuchungen wurde ein probabilistisches Modell zur Abschätzung der Tragfähigkeit von BSH-Trägern entwickelt, das mit den Versuchsresultaten gut übereinstimmte. Das Modell ermöglicht auch die Analyse grundlegender Fragestellungen, etwa zum Volumeneinfluss oder zum Einfluss von Keilzinkungen auf die Steifigkeit und Tragfähigkeit von BSH-Trägern.
Die maschinelle Sortierung erlaubt es, die aufgenommenen Eigenschaften jedes einzelnen Holzbretts zu dokumentieren. Kombinierte Prozesse des Sortierens und der Herstellung könnten in Zukunft zu BSH-Trägern mit bekanntem Aufbau führen. Die jeweiligen Materialeigenschaften liessen sich so gut einschätzen. Dieses Vorgehen könnte zu einem deutlich zuverlässigeren Baumaterial führen. Zum Beispiel könnten BSH-Träger mit niedrigen Schätzwerten aussortiert und einer tieferen Sortierklasse zugeordnet werden.
Stabilität von druckbeanspruchtem BSH
Sehr oft sind Holzkonstruktionen aus stabförmigen Bauteilen zusammengesetzt. Der Konstrukteur muss also die Stabilität druckbeanspruchter Bauteile wie BSH-Stützen gut kennen. Matthias Theiler (dsp Ingenieure & Planer, Greifensee) hatte dieses Thema im Rahmen seiner vor kurzer Zeit abgeschlossenen Promotionsarbeit (ETH Diss. Nr. 22062, 2014) umfassend analysiert und führte dazu aus, dass sich die in der Norm SIA 265 (2012) und dem Eurocode 5 (EN 1995-1-1) festgelegten Bemessungskonzepte nach Theorie II. Ordnung optimieren lassen. Die theoretischen, experimentellen und numerischen Untersuchungen in bezug auf das Knicken von Stäben zeigten auch, dass die Bemessung anhand des Ersatzstabverfahrens normalerweise zu sicheren und auch wirtschaftlichen Resultaten führt.
Für die Versuche wurden 50 Brettschichtholzstützen mit einem Querschnitt von 140 x 160 mm eingesetzt. Bei den Experimenten handelte es sich um Knickversuche; die Prüfkörper wurden mit einer exzentrischen Normalkraft bis hin zum Versagen belastet. Parallel dazu erfolgten numerische Untersuchungen, welche die Streuung der Materialeigenschaften berücksichtigten – ein bei Holzbauten wesentlicher Faktor. Dabei zeigte sich, wie Bemessungskonzepte nach Theorie II. Ordnung verbessert werden könnten.
Brandsicherheit
Neue Anforderungen hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit von Klebstoffen, insbesondere in Nordamerika, verbannen praktisch die neuartigen Klebstoffe vom Markt. Allerdings gründen diese Anforderungen nicht auf einer wissenschaftlichen Basis. Das Ziel der von Michael Klippel (ETH Zürich) durchgeführten Promotionsarbeit (ETH Diss. Nr. 21843, 2014) war es, wissenschaftlich begründete Anforderungen in diesem Bereich zu analysieren und identifizieren.
Es wurden zwölf verschiedene Klebstoffe untersucht, die entweder im strukturellen Holzleimbau zur Anwendung kommen oder aber über keine Zulassung dafür verfügen und beispielsweise in der Möbelindustrie verwendet werden. Keilgezinkte Holzlamellen dienten für umfassende Brandversuche. Sie wurden unter Zugbelastung und einem Normbrand in einem kleinen Horizontalofen bei der Empa geprüft. Diese experimentellen Untersuchungen wurden durch numerische Simulationen erweitert – wiederum mit Blick auf den Einfluss der Klebstoffe auf den Feuerwiderstand von BSH-Trägern.
Vier zentrale Schlussfolgerungen lassen sich ziehen: Die in Europa für den tragenden Holzleimbau zertifizierten Klebstoffe erreichen auch im Brandfall von BSH eine ausreichende Festigkeit. Da Holzbauteile unter Brand im Innern keine hohen Temperaturen aufweisen, müssen Klebstoffe für BSH bis ca. 140°C ausreichende Festigkeit aufweisen; höhere Anforderungen scheinen wissenschaftlich nicht begründet. Kein signifikanter Einfluss wurde bei den zertifizierten Klebstoffen auf den Feuerwiderstand von BSH beobachtet. Die vereinfachte Methode mit reduziertem Querschnitt für die Brandbemessung von Holzbauteilen nach der Norm SIA 265 (2012) und dem Eurocode 5 (EN 1995-1-2) kann unabhängig vom verwendeten zertifizierten Klebstoff angewandt werden.
Auf Querzug beanspruchte Bereiche
Holz ist grundsätzlich in Faserrichtung gut auf Druck und Zug belastbar, quer zu Faser zeigt es insbesondere bei Zugkräften ein sprödes Versagen. Eine planmässige Beanspruchung auf Querzug ist deshalb zu vermeiden. Diese Forderung lässt sich aber nicht immer erfüllen, so bei Queranschlüssen, Ausklinkungen im Auflagerbereich, bei Durchbrüchen an Biegeträgern sowie bei gekrümmten Trägern und Satteldachträgern.
Robert Jockwer (ETH Zürich) hat dieses Thema im Rahmen seiner in 2014 abgeschlossenen Promotionsarbeit (ETH Diss. Nr. 21825, 2014) umfassend analysiert und hielt fest, dass Bereiche, in denen Querzugspannungen nicht zu vermeiden sind, unbedingt verstärkt werden müssen. Er zeigt die verschiedenen Versagensarten und stellt die Bemessungsgrundlagen für Querschlüsse und Ausklinkungen dar.
Verstärkungen von BSH können aufgrund zweier unterschiedlicher Gründe erforderlich werden: zum einen in Bereichen mit im Vergleich zum Tragwiderstand hohen Beanspruchungen, so etwa in Lasteinleitungsbereichen oder Ausklinkungen in BSH-Elementen. Verstärkungen von BSH kommen zum andern bei Sanierungen oder Nutzungsänderungen zum Einsatz, beispielsweise bei teilweisen Delaminationen oder für eine nachträgliche Erhöhung des Tragwiderstands eines BSH-Teils.
Robert Widmann (Empa, Dübendorf) zeigte auf, wie sich bestehende BSH-Konstruktionen optimieren lassen. Verstärkungen sind insbesondere bei Zug- und Druckkräften senkrecht zur Faser, Belastung durch Schub, Biegung und bei Lochleibungen notwendig. Widmann wartete mit einer Übersicht zu den in der Schweiz häufig angewendeten Verstärkungsmassnahmen für BSH-Elemente auf. Sie betreffen Verstärkungen mit Holzwerkstoffen, das Auspressen von Rissen und Delaminierungen, Verstärkungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln und Biegeverstärkungen.
Link www.s-win.ch